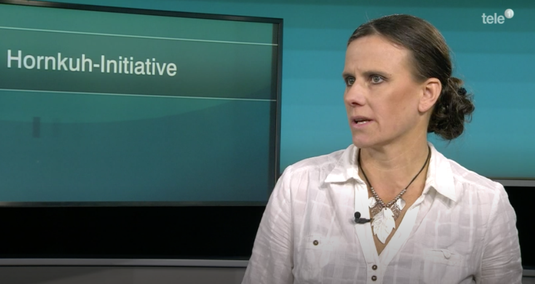Warum setzt sich Priska Welti/Stiäräflüsterin, ganz spezifisch auch für die "Stiärä"-Haltung ein?
"Natur pur ist das Tierfreundlichste, Wertvollste und Beste. Die «Stiärähaltung» braucht viel Fingerspitzengefühl und ist eine Leidenschaft von TierzüchterInnen, einfach etwas wunderschön
Uriges und gehört zu einer harmonischen Tiergemeinschaft. Einen so richtigen «Stiär» in einer Viehherde zu «händeln» ist
so edel wie das Matterhorn in der Schweiz" sagt Priska Welti. Sie möchte das Feuer dieser Leidenschaft vor allem jungen, selbstsicheren Bauern und Bäuerinnen
weitergeben.
Vor- und Nachteile der Stieren-Haltung
Als leidenschaftliche Bergbäuerin ist es mir ganz wichtig, auch in der Tierzucht mit der Kraft der Natur zu arbeiten. Darum hatte ich mir schon mein halbes
Leben einen eigenen Stier gewünscht, den ich mir mit Einwilligung meines Mannes endlich im letzten Frühling 2018 kaufen durfte. Im letzten Sommer genoss unser «Stiär Viktor» die tägliche
Sommerweide auf der Bergalp in seiner Kuhherde. Noch nie hatte ich in meinen fast vierzig Bergälpler-Jahren so eine harmonische Viehherde erlebt. Aber ein «Stiär isch ä Stiär» und kann ab und zu
auch einen «Stiärägrind» haben!
Es gilt, den richtigen, vertrauten Umgang mit diesen männlichen feinfühligen Wesen wieder zu erlernen. Ja, einen Stier zu halten braucht viel Mut und Vertrauen, wie
ich aus eigener Erfahrung sagen kann. Darum wünsche ich auch vielen anderen TierhalterInnen, wieder den Mut und das Vertrauen zu finden, Horntiere in ihrer ganzen vollkommenen Wesensart zu
halten. Auch der Umgang mit den gefährlichen Maschinen: Traktor, Transporter, Seilwinden, Krahn, Stapler, Autos, Motorrad etc. muss gelernt sein, man muss dringend die
Verkehrsregeln beachten sonst kann dies zu fatalen und tödlichen Unfällen führen!
Eine der Motivationen für meine Stieren-Haltung ist das schlimme Geschäft, das schon seit gut 30 Jahren geführt wird. Teilweise wird mit dem
tierquälerisch gewonnenen Blutserum von Pferden die Tiermast und die Fruchtbarkeit in verschiedenen Tierarten wie Schweine, Rinder und auch Pferde gesteigert. Diese Medikamente, Hilfsstoffe
(Tierarzneimittel) werden auch in Europa verkauft, somit auch in der Schweiz. Deswegen setze ich mich aus tiefster Überzeugung für eine möglichst natürliche Tierhaltung ein. Denn jeder
Schritt, den wir ohne Natur machen, ist schlussendlich ein Schritt gegen die NATUR.
Anfänglich hatte ich riesen Respekt und wirklich auch Angst, unseren "Stiär Viktor" zu führen und zu "händeln", weil ich diesen Tierumgang mit den männlichen
Rinderwesen nie kannte und erlernen durfte. Zu meiner Zeit als kleines Kind auf dem Bauernhof wurde die Stierenhaltung intensiv durch den technischen Fortschritt, die (KB) ganz einfach und
unbewusst von der Menschheit ersetzt. Ja, man hat begonnen, sozusagen die Stiere unnatürlich in Gruppenhaltungen zu halten, fernab eines sozial austauschenden Umfeldes einer normalen
Tiergemeinschaft.
Gerne nahm ich mir den Rat eines erfahrenen Stierenhalters zu Herzen, er sagte einfach: "Tägliche Übung, Erfahrung und Grundwissen macht den
Meister."
VORTEILE: Wenn wir einen eigenen Stier in der Herde halten, dann ist der natürliche Kreislauf vollkommen und Kühe und Rinder werden besser "stiärig". Es braucht
keine anderen tierischen, künstlichen oder synthetischen Hilfsmittel mehr, sofern die Viehherde ihr richtiges und gutes Grundfutter bekommt und die Haltung möglichst naturnah ist.
Welche wichtigen Aufgaben ein richtig guter "Stiär" in seiner Viehherde übernimmt, können wir in den angefügten Kurzvideos sehen.
NACHTEILE der Stierenhaltung sind: Mehr Arbeit, etwas Geld & Zeit, ein grösserer Risikofaktor der Sicherheit des Menschen, als nur mit
Kühen.
Wenn der Stier nicht so gute Erbfaktoren mit sich bringt, kann sich dies auf die Nachzucht negativ auswirken.
Mit liäbä Griässli, Priska Welti
Kühe leiden unter dem Enthornen ein Leben lang
Online-Ausgabe Luzerner Zeitung von Eva Novak 19.8.2018
Erstmals zeigt eine wissenschaftliche Studie, dass das Ausbrennen der Hörner die Schmerzempfindlichkeit eines grossen Teils der Kälber beeinflusst
– ihr ganzes Leben lang.
Es gebe keine Studien, «die belegen, dass das Enthornen das Wohlergehen der Tiere unverhältnismässig beeinträchtigt»: So argumentierte der Bundesrat in seiner
Botschaft zur Hornkuh-Initiative und beantragte folgerichtig, diese zur Ablehnung zu empfehlen. Doch nun, nachdem das Parlament der Regierung gefolgt ist, besagt eine wissenschaftliche
Untersuchung das Gegenteil. Sie zeigt, dass Kälber nicht nur gleich nach dem Ausbrennen der Hornansätze an Schmerzen leiden, sondern noch Monate danach.
Zu diesem Befund zu kommen, war nicht so einfach – schon nur, weil Tiere nicht sprechen können. «Schmerz ist eine individuelle Empfindung, und das lässt sich nur
mit Worten beschreiben», sagt Claudia Spadavecchia, Professorin für Veterinäranästhesiologie und Schmerztherapie an der Vetsuisse-Fakultät der Universität Bern. Verhaltensänderungen seien
bei chronischen Schmerzen nicht zu erwarten, denn Rinder seien von ihren Anlagen her Beutetiere: «Um Raubtieren nicht als leichte Beute aufzufallen, dürfen sie chronischen Schmerz nicht zeigen
und versuchen, ihn zu verstecken.»
Erhöhte Empfindlichkeit auch drei Monate danach
«Was Tiere genau empfinden, können wir nur aufgrund ihrer Reaktion auf gut quantifizierbare Reize erahnen», so Spadavecchia. Dies vor Augen, bediente sich ihr Team
der Uni Bern innovativer neurophysiologischer sowie physikalischer Methoden, um den gefühlten Folgen des Enthornens auf die Schliche zu kommen. Mit speziellem Laser, einem druckerzeugenden
Gerät und sogenannten Von-Frey-Filamenten wurde geprüft, wie empfindlich 30 Kälber auf Druck am Kopf rund um den Hornansatz reagieren. Der erste Teil der Studie, dessen Ergebnisse im Februar
dieses Jahres publiziert wurden, bezog sich auf die Zeit unmittelbar nach dem Eingriff. Danach litten in den ersten 24 Stunden nach dem Wegbrennen der Hörner praktisch alle untersuchten Kälber
an Schmerzen, obwohl sie während des Eingriffs bestmöglich mit lokalen Betäubungs- und Schmerzunterdrückungsmitteln versorgt worden waren. Dies galt unabhängig davon, ob die Enthornung
bereits eine Woche oder erst vier Wochen nach der Geburt vorgenommen wurde.
Brisanter ist der Befund des zweiten, noch nicht veröffentlichten Teils der Untersuchung. Erstmals überhaupt zeigte sich, dass die erhöhte Schmerzempfindlichkeit
bei 38 Prozent der enthornten Kälber auch drei Monate später noch anhielt. Sie empfanden schon bei leichter, normalerweise nicht schmerzhafter Berührung Schmerz und reagierten empfindlicher
auf schmerzhafte Reize als nicht enthornte Artgenossen.
Schelbert kritisiert den Bundesrat
Was heisst das für die betroffenen Tiere? Um ihren Kopf zu schützen, sind sie etwa bei Interaktionen mit anderen Tieren eingeschränkt oder bewegen den Kopf beim
Fressen durch die Gitterstäbe so wenig wie möglich, damit es ihnen nicht wehtut. Diese Strategien mussten die untersuchten Kälber ihr ganzes Leben lang anwenden. Denn das dauerte so lang wie
die Studie, im Alter von drei Monaten wurden sie geschlachtet.
Wie sich die Schmerzempfindlichkeit später entwickelt, wurde bisher nicht analysiert. «Es könnte sein, dass der Prozentsatz mit der Zeit abnimmt, aber wir wissen
es nicht», erklärt die Tier-Schmerztherapeutin. Sie weist auf Parallelen zu uns Menschen hin: Auch da litten nach normalen Operationen zwischen 30 und 40 Prozent der Patienten jahrelang an
chronischen Schmerzen.
Einer verfolgt Spadavecchias Untersuchungen mit besonderem Interesse: Der grüne Luzerner Nationalrat Louis Schelbert hatte den Bundesrat per Motion verpflichten
wollen, untersuchen zu lassen, ob Enthornen zu Phantomschmerzen führt. Zu Schmerzen also, wie sie bei Menschen mit amputierten Gliedmassen auftreten können, aber auch bei Hühnern, deren
Schnabel coupiert wurde. Nachdem ihn der Bundesrat auf die laufenden Untersuchungen der Vetsuisse-Fakultät aufmerksam gemacht hatte, zog Schelbert seinen Vorstoss zurück. Inzwischen ist er
selber aus dem Nationalrat zurückgetreten – und findet es «skandalös, dass die Erkenntnisse den Bundesrat und die zuständigen Bundesämter nicht interessieren».
«Die Verwaltung hätte erste Ergebnisse in die Botschaft einarbeiten können oder mit der Publikation noch ein bisschen zuwarten können – aber nichts geschah»,
kritisiert er.
Spätestens jetzt müssten Bundesrat und Verwaltung zugeben, dass Enthornen für viele Tiere problematisch sei, findet Schelbert. Und kommt zum Schluss: «Das
Tierwohl ist schlicht nicht gefragt.» Ob sich interessierte Stimmbürgerinnen und Stimmbürger aus erster Hand informieren und eine eigene Meinung bilden werden können, ist mehr als fraglich.
Denn die Studie ist zwar zur Publikation eingereicht. Doch es wird, wie Spadavecchia befürchtet, kaum bis zum Abstimmungssonntag reichen.
Das will die Initiative
Die Hornkuh-Initianten um Bergbauer Armin Capaul fordern, dass der Bund Tierhalter finanziell unterstützt, wenn sie ihre Kühe und Ziegen nicht enthornen. Wie viel
Geld die Bauern pro Tier erhalten sollen, lässt der Initiativtext offen. Ursprünglich hatte Capaul einen Hörnerfranken gefordert: einen Franken pro Kuh und Tag. Die Kosten sollen gemäss den
Initianten anderswo im Landwirtschaftsbudget eingespart werden – wo genau, ist ebenfalls offen.
Ziel der Initianten ist es, dass weniger Tiere enthornt werden. Bundesrat und Parlament empfehlen die Initiative zur
Ablehnung. Abgestimmt wird am 25. November 2018. (mjb)